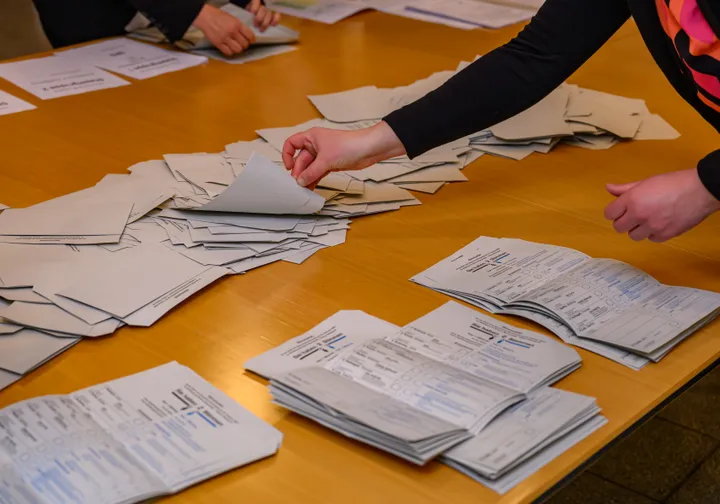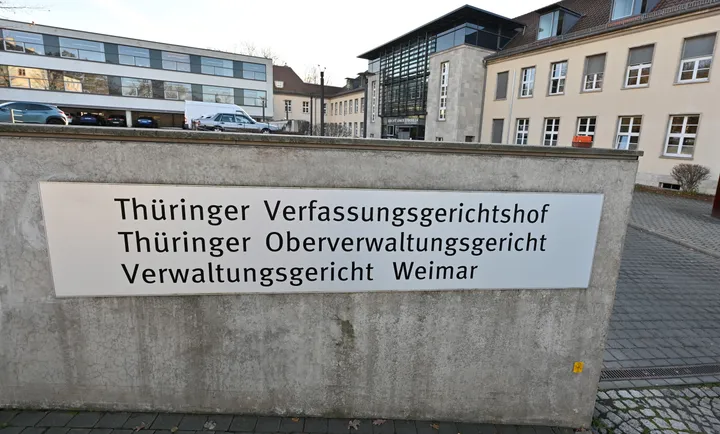Inmitten der Spannungen zwischen Moskau und Kiew wegen des Konflikts in der Ostukraine hat Russland einen Diplomaten des Nachbarlandes wegen Spionageverdachts ausgewiesen. Der ukrainische Konsul in St. Petersburg müsse das Land verlassen, teilte das Außenministerium am Samstag in Moskau mit. Zuvor war er vom Inlandsgeheimdienst FSB festgenommen worden. Russland schickte zudem 15 Kriegsschiffe für ein Manöver ins Schwarze Meer.
Das russische Außenministerium bestellte den ukrainischen Geschäftsträger Vassili Pokotilo ein, um gegen die „illegalen Aktivitäten“ Sosonjuks zu protestieren. Diese seien nicht mit dem Diplomatenstatus vereinbar und schadeten den russischen Sicherheitsinteressen, teilte das Ministerium mit und erklärte Sosonjuk zur „unerwünschten Person“. Er solle innerhalb von 72 Stunden das Land verlassen.
Das ukrainische Außenministerium sprach von einer „weiteren Provokation“ der russischen Sicherheitsbehörden. Demnach wurde Sosonjuk mehrere Stunden nach seiner Festnahme am Freitag wieder freigelassen. Er befinde sich derzeit im ukrainischen Konsulat.
In den vergangenen Jahren hatte Russland wiederholt ukrainische Staatsbürger wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen. Dass es einen Diplomaten trifft, ist jedoch selten.
Russland verlegt zehntausende Soldaten
Seit einigen Wochen spitzt sich die Lage zwischen Kiew und Moskau im Ukraine-Konflikt wieder zu. Kiew und seinen westlichen Verbündeten bereitet vor allem die Verlegung zehntausender russischer Soldaten an die ukrainische Grenze große Sorgen.
In dem seit 2014 andauernden Konflikt mit pro-russischen Separatisten in der Ost-Ukraine wurden mehr als 13.000 Menschen getötet. Im Juli vergangenen Jahres hatten sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt. Seit Mitte Februar gibt es aber verstärkte Kampfhandlungen, die den ohnehin fragilen Waffenstillstand untergraben. Moskau und Kiew machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.
Die Nato kritisierte am Freitagabend russische Pläne, die Schifffahrt im Schwarzen Meer teilweise einzuschränken. Dies sei ein „ungerechtfertigter Schritt und Teil eines größeren Musters von destabilisierendem Verhalten durch Russland“, erklärte eine Nato-Sprecherin und und verlangte von Russland eine freie Schiffsdurchfahrt zu den ukrainischen Häfen am Asowschen Meer.
Russlands „fortdauernde Militarisierung der Krim, des Schwarzen Meers und des Asowschen Meers“ seien „weitere Bedrohungen für die Unabhängigkeit der Ukraine und untergraben die Stabilität in der Region“, fügte die Sprecherin hinzu.
Entwicklung „sehr besorgniserregend“
Die Erklärung der Nato erfolgte kurz nach der Ankündigung Russlands, ab dem 24. April bis Ende Oktober die Durchfahrt ausländischer Militärschiffe durch drei Wasserstraßen in der Nähe der Krim-Halbinsel einzuschränken. Dies gelte auch für andere Schiffe in staatlichem Besitz, zitierte die Nachrichtenagentur Ria Nowosti das russische Verteidigungsministerium. Russland hatte die Krim im März 2014 annektiert. Kürzlich hatte Moskau neue Marinemanöver in den Gewässern aufgenommen.
Ein hochrangiger EU-Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, nannte die Entwicklung „sehr besorgniserregend“. „Das ist ein weiterer Schritt der russischen Regierung, der in die falsche Richtung geht“, sagte er. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, erklärte, Russland begründe die Pläne mit der Vorbereitung von Militärübungen. Allerdings sei Russland immer wieder „aggressiv“ gegen ukrainische Schiffe vorgegangen und behindere den internationalen Schiffsverkehr im Schwarzen Meer, vor allem an der Straße von Kertsch.
Die Pläne des russischen Verteidigungsministeriums beziehen sich auf die westliche Spitze der Krim, den Abschnitt von Sewastopol bis Hursuf und ein „Rechteck“ vor der Halbinsel Kertsch. Dieser Bereich ist besonders umstritten, weil die Meerenge von Kertsch das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer verbindet. Über diesen Schifffahrtsweg wickelt die Ukraine ihre Getreide- und Stahlexporte ab.