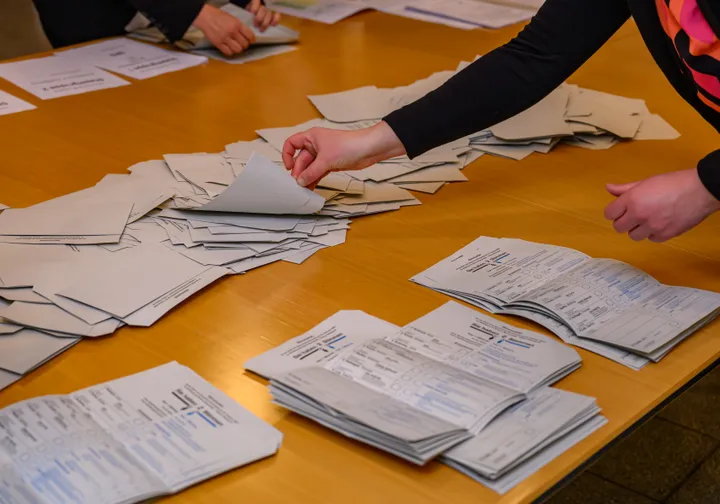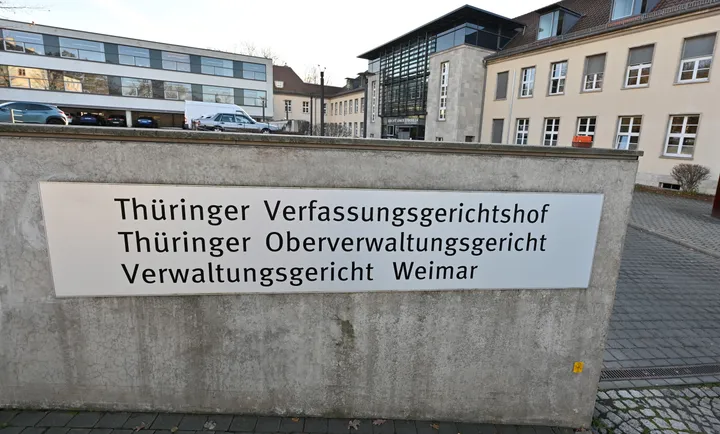Es war ein epochaler Streit, hitzig, verletzend, polemisch. „Noch nie hat eine Frage die Gemüter unseres Volkes so erregt, noch nie sind sich die Meinungsfronten so unerbittlich gegenübergestanden“, hielt Außenminister Walter Scheel (FDP) am 17. Mai 1972 im Bundestag fest. Noch einmal schäumte dort die Debatte, noch einmal stand es Spitz auf Knopf. Dann gelang der sozialliberalen Koalition an diesem Tag doch die Ratifizierung des Moskauer und des Warschauer Vertrags - der zentralen Ostverträge der Regierung von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD).
Fünfzig Jahre später ist in Zeiten des Ukraine-Kriegs nun viel die Rede von Brandts Ostpolitik - wahlweise als richtungsweisende Leistung oder aber als Grundlage verirrter „Russlandversteher“ in der SPD. „Wandel durch Annäherung“ hieß das von Brandts Berater Egon Bahr geprägte Schlagwort. Oder, wie Scheel sagte: „Es geht um den Versuch, von der Konfrontation zur Kooperation zu kommen.“ Das klingt vertraut aus der Russland-Debatte der vergangenen Jahre. Aber taugt der Vergleich?
„Mit dem Blick zurück auf die Ostpolitik kommt man heutzutage in der Frage des Ukraine-Kriegs nicht mehr viel weiter“, sagt der Historiker Bernd Rother, früher lange wissenschaftlicher Mitarbeiter der Willy-Brandt-Stiftung. „Zur ‚Zeitenwende‘ gehört eben auch die Frage, ob Brandts Ostpolitik heute noch zur Anwendung kommen kann.“ Vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine seien Verhandlungen eine Option gewesen - und viele hätten sie ja auch in Moskau geführt. „Aber der russische Überfall auf die Ukraine hat jetzt eine völlig neue Situation hergestellt“, sagt Rother.
Kleine Schritte, große FragenGenaugenommen unterschied sich schon die Ausgangslage, in der Brandt Ende der 1960er Jahre eine engere Verständigung mit Moskau suchte, erheblich von der Russland-Politik nach dem Kalten Krieg. Wichtigste Motivation für Brandt, vorher Regierender Bürgermeister in Westberlin, waren Verbesserungen im Alltag der durch die Mauer getrennten Ost- und Westdeutschen. Das Schlagwort dazu: „Politik der kleinen Schritte“, etwa bei Besuchsmöglichkeiten und Transitverkehr.
Dafür musste Brandt jedoch die großen politischen Fragen anpacken, die seit Gründung der Bundesrepublik 1949 offen geblieben waren: Erkennt man die DDR als Staat an - das „Phänomen im Osten“, wie es Kanzler Kurt-Georg Kiesinger (CDU) noch nannte? Akzeptiert man die Nachkriegsgrenzen, also die Gebietsverluste in dem von Nazi-Deutschland begonnenen Weltkrieg? Und überhaupt: Darf man mit Kommunisten verhandeln?
Brandt beantwortete letztlich all diese Fragen mit ja und leitete damit einen historischen Kurswechsel ein. „Die neue Ostpolitik der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt löste die Gesprächsstarre zwischen Bonn und Moskau und beendete das Verharren in der ostpolitischen Forderungssackgasse der Bundesrepublik“, urteilte der kürzlich verstorbene Zeithistoriker Manfred Wilke in einer Artikelserie zur Ostpolitik für die Bundeszentrale für Politische Bildung.
Greifbare Ergebnisse waren eben der Moskauer Vertrag mit der Sowjetunion vom 12. August 1970 und der Warschauer Vertrag mit Polen vom 7. Dezember 1970, zwei verblüffend kurze Papiere in wenigen Artikeln. Die zentralen Botschaften: Gewaltverzicht, Achtung der in Europa geltenden Grenzen einschließlich der Oder-Neiße-Grenze und Aufgabe etwaiger Gebietsansprüche.
„Propaganda“ und „unwahre“ BehauptungenBrandt hatte die neue Linie schon als Außenminister der Großen Koalition unter Kiesinger ab 1966 angebahnt und 1969 für die SPD die Bundestagswahl gewonnen. Der Kanzler hatte ein Mandat und entfachte doch eine innenpolitische Krise.
Als Brandt die Verträge am 23. Februar 1972 zur Ratifizierung in den Bundestag einbrachte, kam von Oppositionsführer Rainer Barzel (CDU) eine bittere Absage, gespickt mit Vorwürfen wie „raffinierte Propaganda“, „unwahre“ Behauptungen, Missachtung deutscher Interessen. Es folgte eine insgesamt 22-stündige Redeschlacht. SPD und FDP vertrauten da noch auf ihre eigene Mehrheit. Doch es kam anders. Mehrere Abgeordnete der Koalition traten aus Protest gegen die Ostverträge zur Union über, und die sozialliberale Mehrheit war weg.
Barzel witterte die Chance zum Regierungswechsel und versuchte am 24. April 1972, sich mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zum Kanzler wählen zu lassen. Das scheiterte aus damals rätselhaften Gründen an zwei fehlenden Stimmen. Erst Jahrzehnte später wurde klar: Die DDR-Staatssicherheit hatte den CDU-Abgeordneten Julius Steiner mit 50.000 Mark bestochen und den CSU-Abgeordneten Leo Wagner als Inoffiziellen Mitarbeiter geführt. Die Stasi hatte ein Interesse, Brandt im Amt zu halten und die Ostverträge zu retten.
Das gelang am 17. Mai mit einen parlamentarischen Kompromiss. Zum Ratifizierungsgesetz kam eine „gemeinsame Entschließung“, der Koalition und Union zustimmten - eine Klarstellung zu Kritikpunkten. Bei der Abstimmung zu den Verträgen enthielten sich dann fast alle Abgeordneten von CDU und CSU, und die Ratifizierung war durch.
Es war ein knappes Ergebnis, das noch dazu abhing von Strippenziehern in der DDR. Dennoch wurde die Entspannungspolitik, für die Brandt auch den Friedensnobelpreis bekam, rasch Konsens in der deutschen Außenpolitik. Auch CDU-Kanzler Helmut Kohl führte sie nach 1982 fort. Der Mauerfall, die deutsche Vereinigung, das Ende des Kalten Kriegs: Alles wurde oft beschrieben als Verdienst der Ostpolitik Brandts, der dafür in seiner Partei als Ikone verehrt wurde.
„Das ärgert mich“Nach Ende der DDR und der Sowjetunion änderte sich die Lage. Deutschland war weit weniger abhängig vom Wohlwollen Moskaus und lag statt in Frontstellung recht gemütlich in der Mitte Europas. „Nach 1989 gab es eine neue europäische Friedensordnung“, sagt der SPD-nahe Historiker Rother. „Das sah in den 1990er Jahren ja auch ganz gut aus.“ Erst Ende der Nullerjahre sei das russische Verhältnis zum Westen konfrontativer geworden.
Dass Deutschland trotzdem mit Moskau im Gespräch bleiben wollte, „sehe ich nicht vorrangig als direkte Linie von Brandts Ostpolitik“, sagt Rother. „Es war nicht nur Deutschland und keinesfalls nur die SPD, die auf Verhandlungen mit Russland gesetzt hat.“
In der Abhängigkeit von russischer Energie ging Deutschland allerdings weiter als andere EU-Länder. Das wiederum geht tatsächlich zurück bis zu Brandt, denn 1970 kam mit den Ostverträgen auch das erste Erdgasröhrengeschäft, das im großen Stil russisches Gas nach Westeuropa brachte. Aber auch da gilt: Lange waren diese Geschäfte bis hin zur Nordstream-Pipeline breiter Konsens, getragen auch von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).
Wenn heute vor allem die SPD als zu russlandfreundlich am Pranger steht, zeigt sich nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz genervt. „Seit Adenauers Zeiten gibt es diese verfälschenden und verleumderischen Darstellungen der Europa- und Russlandpolitik der SPD, das ärgert mich“, sagte Scholz dem „Spiegel“. Die Partei will sich die Ostpolitik nicht schlechtreden lassen.
Und doch hat das große Grübeln längst begonnen. SPD-Chefchef Lars Klingbeil sagte jetzt der „Welt am Sonntag“: „Wenn im Grundsatzprogramm der SPD steht, dass Sicherheit in Europa nur mit Russland zu erreichen sei, dann sehen wir: Das stimmt vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges nicht mehr.“ Da wackeln Grundfesten - vielleicht ähnlich heftig wie unter Willy Brandt.