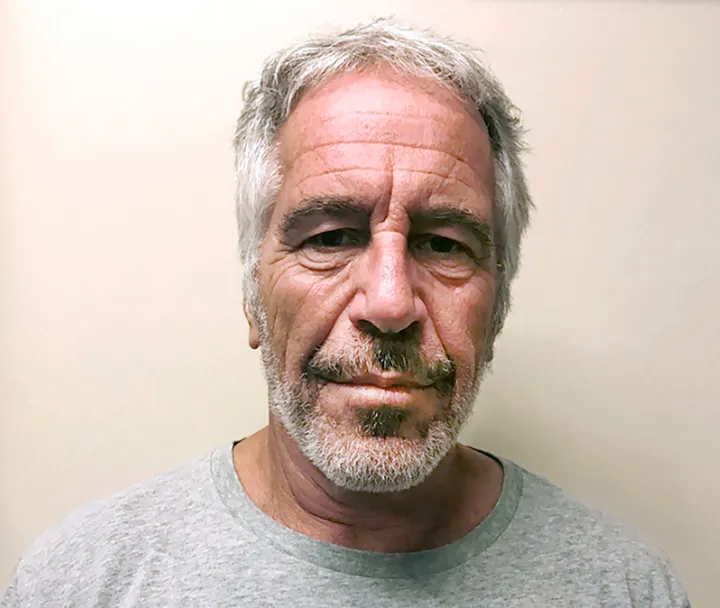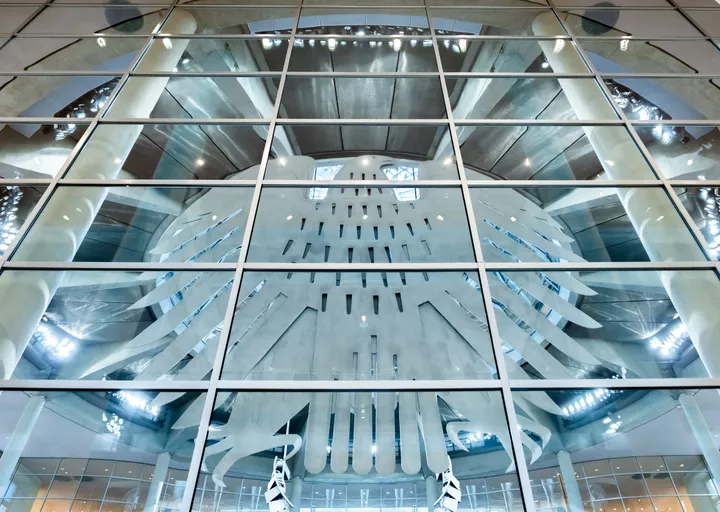Die Eltern von 545 Migrantenkindern, die im Zuge der US-Einwanderungspolitik von ihren Familien getrennt wurden, sind nicht auffindbar. Darüber informierte die US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) nach eigenen Angaben am Dienstag (Ortszeit) das zuständige Gericht. Die Organisation prangerte die „grausame Praxis“ der Regierung von US-Präsident Donald Trump an, die im Jahr 2018 über sechs Wochen Migrantenfamilien an der mexikanischen Grenze voneinander trennen ließ.
Laut einer vom Fernsehsender CNN veröffentlichten Gerichtsakte wurden zwei Drittel der nicht auffindbaren Eltern wahrscheinlich abgeschoben. Der Fernsehsender NBC hingegen berichtete, die verschwundenen Eltern seien bereits seit 2017 in einem Pilotprojekt der US-Regierung von ihren Kindern getrennt und abgeschoben worden.
Ergebnis der „Null-Toleranz“-Politik gegen die illegale Einwanderung
Die Trump-Regierung hatte im Zuge ihrer „Null-Toleranz“-Politik gegen die illegale Einwanderung im Mai 2018 damit begonnen, eingewanderte Kinder von ihren Eltern zu trennen. Nach heftigen Protesten im In- und Ausland beendete Trump die Praxis nach sechs Wochen. Illegal über die mexikanische Grenze gelangte Migrantenfamilien sollten danach nur noch getrennt werden, wenn die Eltern ein „Risiko“ für die Kinder darstellten, hieß es.
Der stellvertretende Direktor des ACLU-Projekts für Migrantenrechte, Lee Gelernt, forderte im Sender NBC Aufklärung. „Es ist entscheidend, so viel wie möglich darüber herauszufinden, wer für diese schreckliche Praxis verantwortlich war“, sagte er. Es dürfe nicht vergessen werden, „dass Hunderte von Familien noch immer nicht gefunden wurden und getrennt bleiben“. Er forderte weitere Anstrengungen, um diese Familien zu finden.
Die Corona-Pandemie hatte die Suche nach den Eltern vorübergehend erschwert. Ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2018 verpflichtet die US-Regierung aber, die voneinander getrennten Familien wieder zusammenzuführen.